Warum höre ich im Alter schlecht?
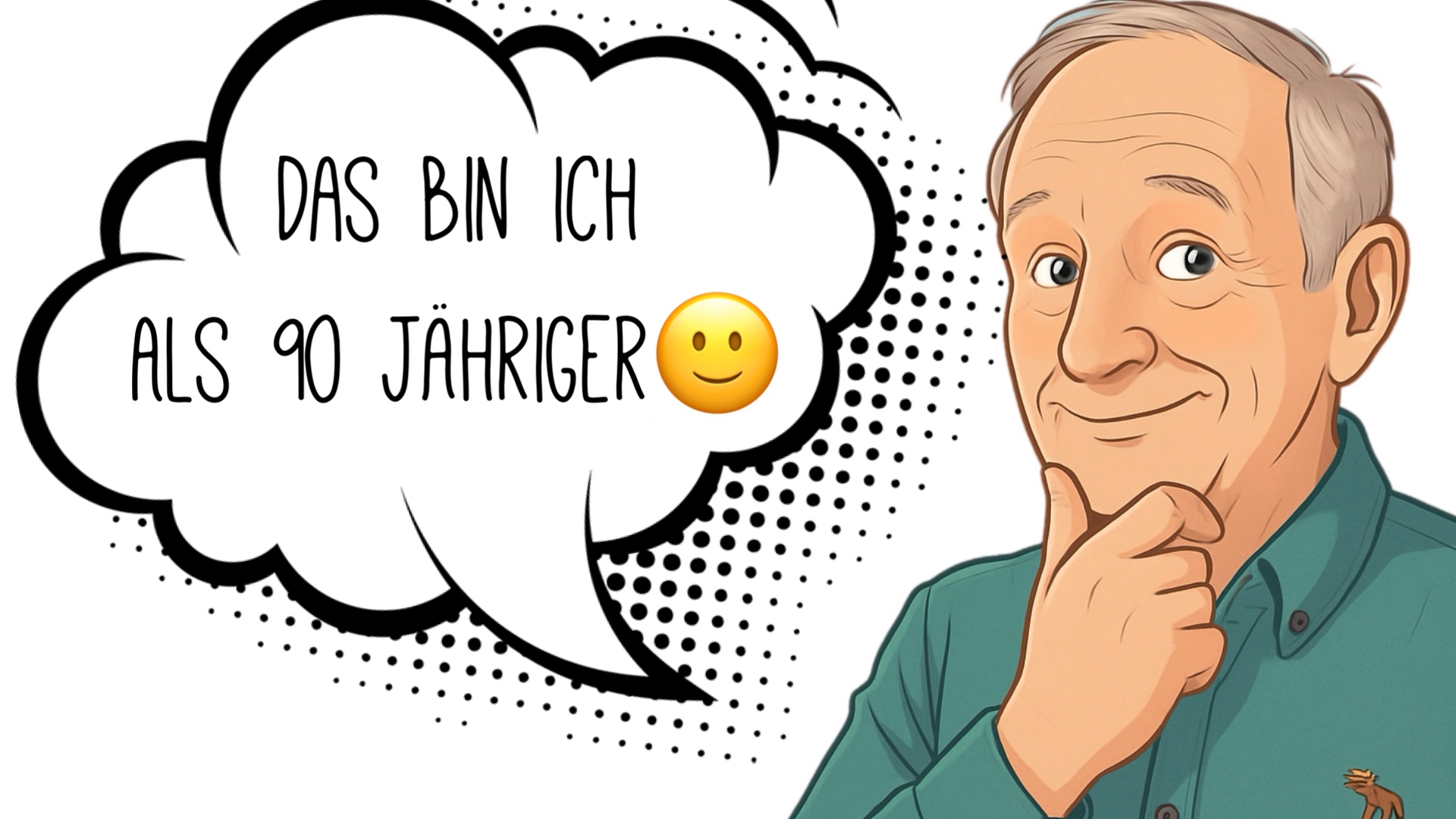
Was sich verändert – und was wirklich hilft
Hören ist ein aktiver, hochkomplexer Vorgang. Mit dem Alter verändert sich dieser Prozess messbar – oft schleichend, aber folgenreich. Besonders hohe Töne verschwinden zuerst. Doch warum ist das so?
Presbyakusis: Wenn das Ohr älter wird
Altersbedingter Hörverlust – medizinisch als Presbyakusis bezeichnet – ist die häufigste Form des Hörverlusts bei älteren Menschen. Es handelt sich dabei um einen symmetrischen, sensorineuralen Hochtonverlust, der langsam fortschreitet und nicht reversibel ist.
Was genau passiert im Innenohr?
Früher ging man davon aus, dass vor allem äußere Haarzellen (OHC) in der Basilarmembran absterben. Heute ist klar: Presbyakusis ist komplexer.

- Synaptopathie: Die Verbindungen zwischen Haarzellen und Hörnerv (Synapsen) gehen verloren – oft bevor die Haarzellen selbst betroffen sind.
- SGC-Verlust: Spiralganglienzellen sterben ab – das führt zu schlechterer Signalweiterleitung trotz erhaltener Haarzellen.
- Oxidativer Stress & mtDNA-Schäden: Altersbedingt häufen sich Schäden in den Mitochondrien, die Zellfunktion leidet.
- Mikrogefäßveränderungen: Die feine Durchblutung im Innenohr nimmt ab, Sauerstoffversorgung sinkt.
Warum gerade hohe Töne?
Die Hörschnecke ist tonotop organisiert – hohe Frequenzen werden an der Basis verarbeitet, tiefe im Apex. Die Basis ist gleichzeitig am stärksten mechanischem Stress, oxidativem Schaden und Lärmeinwirkung ausgesetzt.
Welche Risikofaktoren gibt es?
- Lärmbelastung über Jahre
- Ototoxische Medikamente
- Rauchen, Passivrauchen
- Hoher Blutdruck, Gefäßerkrankungen
- Diabetes mellitus
- Genetische Veranlagung
Welche Folgen hat Presbyakusis im Alltag?
- Gespräche in Gruppen oder Lärm werden schwer verständlich
- Sprachanteile „verschwinden“ (z. B. Zischlaute)
- Richtungshören wird unzuverlässig
- Erhöhte mentale Höranstrengung (Hörstress)
- Erhöhtes Risiko für kognitiven Abbau
- Soziale Isolation, emotionale Belastung
Was hilft wirklich?
- Hörgeräte: verbessern das Sprachverstehen, reduzieren Hörstress und entlasten das Gehirn.
- Cochlea-Implantate: auch im Alter erfolgreich einsetzbar, wenn Hörgeräte nicht ausreichen.
- FM-Anlagen und Assistenztechnik: für TV, Telefon, Gruppengespräche
- Neurokognitives Hörtraining: zur Förderung zentraler Verarbeitungsprozesse
- Gesunder Lebensstil: Bewegung, Blutdruckkontrolle, Rauchstopp, Stressvermeidung
Fazit
Altersbedingter Hörverlust ist normal – aber nicht trivial. Besonders der Verlust hoher Frequenzen ist erklärbar, messbar und behandelbar. Wer früh handelt, kann das Hörvermögen stabilisieren, das Sprachverstehen erhalten und die Lebensqualität verbessern.
Newsletter
Mit einer Anmeldung für unseren kostenfreien Newsletter erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen rund um unser Unternehmen. Zudem erhalten Sie kostenfrei den Downloadlink zur begehrten Hörakustiker-Checkliste.
